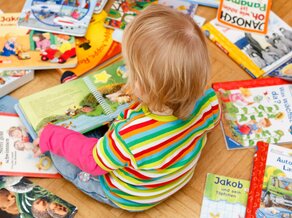Bad Homburg v. d. Höhe. Seit 2017 ist die historische Villa Wertheimber Sitz des Stadtarchivs Bad Homburg. Was liegt da näher, als die Geschichte der Villa und der dazugehörigen historischen Parkanlage zu erforschen? Die Leiterin des Stadtarchivs, Dr. Astrid Krüger, hat hierzu über viele Jahre recherchiert. Die Ergebnisse ihrer spannenden Forschung waren bislang in fünf Aufsätzen sowie deren Zusammenfassungen auf Roll-Ups im Foyer der Villa Wertheimber nachzulesen.
Jetzt hat der Fachbereich Kultur und Bildung, der seit Mai 2024 ebenfalls in der Villa untergebracht ist, gemeinsam mit dem Stadtarchiv neue Schautafeln im Gustavsgarten aufgestellt. Auf diese Weise soll die bewegende Geschichte der Familie Wertheimber und ihrer Villa einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden.
Die Entstehung der Sommerresidenz
Der wohlhabende Frankfurter Bankier Julius Wertheimber und seine Ehefrau Katharina hatten das sogenannte „Accatium“ (den heutigen Gustavsgarten) im Jahr 1898 vom Enkel des 1848 verstorbenen Landgrafen Gustav, Heinrich XXII. Fürst Reuß, erworben, um dort eine Sommerresidenz zu errichten. Julius Wertheimber entstammte einer fränkischen jüdischen Familie, deren Mitglieder bereits im 18. Jahrhundert nach Frankfurt gezogen waren und dort eine Handelsgesellschaft gegründet hatten. Sein Vater Louis Wertheimber gründete 1867 zusammen mit seinem Bruder Emanuel das Frankfurter Bankhaus L. & E. Wertheimber.
Mit dem Bau der Sommerresidenz beauftragte das Ehepaar den Architekten Franz von Hoven, der unter anderem für das Senckenbergmuseum (1904–1908), das Bürgerhospital (1904) und den Erweiterungsbau des Städels (ab 1915, mit Franz Heberer) bekannt wurde. Der imposante Bau wurde westlich eines Dorischen Tempels errichtet, der noch aus der Zeit Landgraf Gustavs stammte. Die Villa ist im Grundbestand bis heute erhalten geblieben, jedoch ging ein Großteil der ursprünglichen Verzierungen verloren. Nur in der Loggia sind noch einzelne dekorative Elemente sichtbar.
Flucht und Enteignung in der NS-Zeit
Nach dem Tod von Katharina und Julius Wertheimber lebte ab 1935 nur noch ihre Tochter Juliane Krahmer in der Villa. Sie begann 1937, erste Stücke aus dem Nachlass ihrer Eltern zu veräußern – eine Reaktion auf die zunehmende Ausgrenzung jüdischer Menschen im nationalsozialistischen Deutschland. Im Herbst 1938 besuchte sie ihre Schwiegertochter Alix de Rothschild in Paris und kehrte nicht mehr nach Deutschland zurück. Die Villa Wertheimber und die Parkanlage, die seit 1939 mit einer Sicherungshypothek für die bei Emigration fällige „Reichsfluchtsteuer“ belastet waren, verkaufte sie im März 1940 an eine Tochtergesellschaft der Dresdner Bank.
Am 11. August 1940 nahm sich Juliane Krahmer in Ville d’Avray bei Paris das Leben, da sie angesichts der drohenden Besetzung der Stadt durch deutsche Truppen keine Lebensperspektive mehr für sich sah.
Nutzung in Kriegs- und Nachkriegszeit
1942 verpachtete die Dresdner Bank Villa und Park an die Stadt Frankfurt, die dort eine Marinemusikschule einrichtete. Musikbegabte Jungen im Alter von 14 bis 18 Jahren sollten dort „im nationalsozialistischen Geiste“ zu Militärmusikern ausgebildet werden. Doch bereits im Herbst 1944 wurde die Schule kriegsbedingt geschlossen. Die Villa wurde anschließend an die Frankfurter Maschinenbau AG (vormals Pokorny & Wittekind) übergeben.
Nach dem Einmarsch der Alliierten wurde die Villa für kurze Zeit von der amerikanischen Besatzungsmacht beschlagnahmt. Danach stand sie fast ein Jahr leer. Ab Oktober 1946 wurde sie an den Frankfurter Verein Hirnverletztenheim e. V. verpachtet, der dort 1947 eine Klinik für Kriegsversehrte mit Spezialisierung auf Kopfverletzungen eröffnete.
Rückerstattung und spätere Nutzung
Ende 1948 forderten die Erben von Juliane Krahmer gemäß den Rückerstattungsgesetzen die Rückgabe des Anwesens. Sie lebten inzwischen in Frankreich und den USA. Die Rhein-Main-Bank, ein Nachfolgeunternehmen der Dresdner Bank, verweigerte die Rückgabe zunächst mit dem Argument, der Verkauf sei freiwillig und zu einem angemessenen Preis erfolgt. 1951 wurde der Fall an die Wiedergutmachungskammer des Landgerichts Frankfurt verwiesen.
Den Erben gelang es, nachzuweisen, dass der Verkauf des Anwesens unter politischem Druck und unter Wert erfolgt war. Im Mai 1953 einigte sich die Familie mit der Rhein-Main-Bank auf eine Rückgabe gegen Rückzahlung des ursprünglichen Kaufpreises.
Von der Klinik zur Bürgernutzung
Ende 1954 verkauften die Erben Villa und Park an die Bundesrepublik Deutschland. Diese übergab das Anwesen dem Verein Hirnverletztenheim in Erbpacht. Ab 1977 wurde die Einrichtung zu einer neurologischen Fachklinik umgewandelt, die Ende 2003 geschlossen wurde.
Das Gelände lag danach bis zum Erwerb durch die Stadt Bad Homburg im Jahr 2011 brach. Der Kauf des gesamten Areals war ein Glücksfall für die Stadt, denn so konnte der letzte erhaltene Prinzengarten – der Gustavsgarten – mitsamt der Villa Wertheimber nach umfassender Sanierung wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Heute wird das Ensemble rege zur Erholung und für kulturelle Veranstaltungen genutzt.
Eine Geschichte, die weiterlebt
Die Geschichte der Familie Wertheimber ist damit noch nicht zu Ende erzählt: Stadtarchivarin Dr. Astrid Krüger hat inzwischen Kontakt zu einer Nachfahrin aufgenommen – einer in Frankreich lebenden Urenkelin von Katharina und Julius Wertheimber.
Die über 80-jährige Catherine Krahmer, Tochter von Julianes Sohn Hans-Werner, wuchs auf dem ostpreußischen Gut Draulitten auf, das ihre Familie zwischen 1933 und 1944 bewohnte.
Nach der Flucht vor der Roten Armee emigrierte die Familie nach Frankreich. In den letzten Jahren hat Catherine Krahmer ihre Erinnerungen unter dem Titel „Von Ostpreußen nach Frankreich – Eine Odyssee der vierziger Jahre“ niedergeschrieben. Darin enthalten sind zahlreiche Einblicke in das Leben ihrer Großmutter Juliane Krahmer und die Geschichte der Familie Wertheimber.
Diese eindrucksvolle Lebensgeschichte soll bald – möglichst im Beisein von Catherine Krahmer – in der Villa Wertheimber vorgestellt werden.