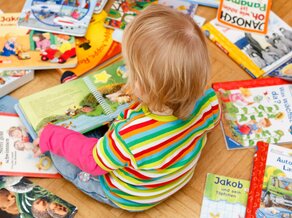Widerständigkeit, Kollaboration und Partikularinteressen.
Rekatholisierung als gemeindliches Ereignis in Ober-Erlenbach und Oberursel am Beginn des 17. Jahrhunderts
Vortrag in der Reihe "Aus dem Stadtarchiv. Vorträge zur Bad Homburger Geschichte"
Referent: Professor Dr. Alexander Jendorff (Justus-Liebig-Universität Gießen)
Am Beginn des 17. Jahrhunderts setzte in Ober-Erlenbach und Oberursel die Rekatholisierung durch die Kurmainzer Herrschaft ein. Sie vollzog sich innerhalb von zwei Jahren und führte zu einem kirchlich-konfessionellen Wandel in zwei Gemeinden, die über Jahrzehnte hinweg lutherisch gewesen waren. Angesichts des Tempos der Entwicklung muss sich die Frage stellen, welche Faktoren für den Wandel verantwortlich waren und ihn beförderten. Dies kann umso mehr interessieren, weil sich die wissenschaftliche Forschung über Jahrzehnte hinweg mit der sogenannten Gegenreformation als einem obrigkeitlichen Akt beschäftigt hat, so als ob sämtliche damit verbundenen Maßnahmen von den jeweiligen Regierungen gewaltsam durchgeführt worden seien. Immer deutlicher wird neuerdings aber, dass es sich – wie schon bei der Reformation – um einen vielschichtigen Problemkreis handelt, der verschiedene Forschungsfelder miteinander verbindet: die Kirchen- und Religionsgeschichte ebenso wie die Herrschafts-, und Elitengeschichte, die Stadt- und Gemeindegeschichte und nicht zuletzt die jeweilige Regionalgeschichte. Diese komplexe Gemengelage versucht der Vortrag aufzuschlüsseln und einzuordnen.